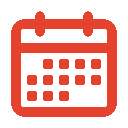Chefs unterschätzen ihre Versorgungslücke
Altersvorsorge: Geschäftsleiter öffentlicher Unternehmen halten einen kompletten Übergang zur Eigenvorsorge meist für unzumutbar. Umfragen zeigen regelmäßig: Die betriebliche Altersversorgung (bAV) der Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen ist für sie die wichtigste Zusatzleistung.

Director | Compensation & Performance Management

Manager | Compensation & Performance Management
Kienbaum hat dazu Betroffene, Aufsichtsräte und Beteiligungsmanager befragt und stellt die Ergebnisse hier erstmals außerhalb des Teilnehmerkreises vor.
Demnach sind Versorgungszusagen neben der monetären Vergütung ein bedeutsamer Faktor für die Gewinnung und Bindung von Geschäftsleitern. Dieser Aussage stimmten 89 Prozent der befragten Chefs sowie 72 Prozent der Aufsichtsräte und Beteiligungsmanager zu.
Dies verwundert nicht weiter: Sofern die Geschäftsleiter überhaupt rentenversicherungspflichtig sind, reicht die spätere gesetzliche Rente angesichts von Geschäftsleiterbezügen, die in aller Regel deutlich oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, kaum aus, um im Ruhestand den Lebensstandard aufrechtzuerhalten.
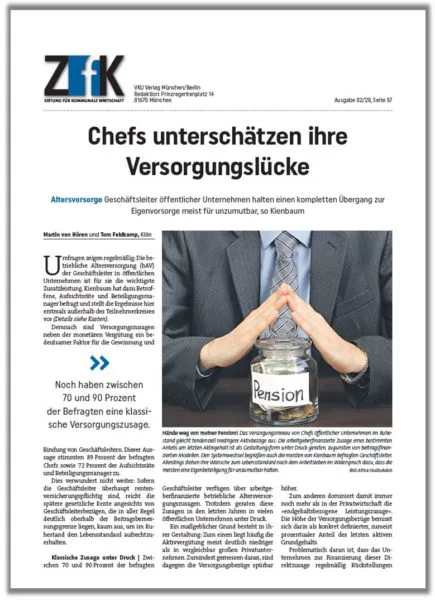
Hände weg von meiner Pension! Das Versorgungsniveau von Chefs öffentlicher Unternehmen im Ruhestand gleicht tendenziell niedrigere Aktivbezüge aus. Die arbeitgeberfinanzierte Zusage eines bestimmten Anteils am letzten Aktivgehalt ist als Gestaltungsform unter Druck geraten, zugunsten von beitragsfinanzierten Modellen. Den Systemwechsel begrüßen auch die meisten von Kienbaum befragten Geschäftsleiter. Allerdings stehen ihre Wünsche zum Lebensstandard nach dem Arbeitsleben im Widerspruch dazu, dass die meisten eine Eigenbeteiligung für unzumutbar halten.
“Noch haben zwischen 70 und 90 Prozent der Befragten eine Versorgungszusage”
Klassische Zusage unter Druck
Zwischen 70 und 90 Prozent der befragten Geschäftsleiter verfügen über arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgungszusagen. Trotzdem geraten diese Zusagen in den letzten Jahren in vielen öffentlichen Unternehmen unter Druck.
Ein maßgeblicher Grund besteht in ihrer Gestaltung: Zum einen liegt häufig die Aktivvergütung meist deutlich niedriger als in vergleichbar großen Privatunternehmen. Zumindest gemessen daran, sind dagegen die Versorgungsbezüge spürbar höher.
Zum anderen dominiert damit immer noch mehr als in der Privatwirtschaft die »endgehaltsbezogene Leistungszusage«. Die Höhe der Versorgungsbezüge bemisst sich darin als konkret definierter, zumeist prozentualer Anteil des letzten aktiven Grundgehalts.
Problematisch daran ist, dass das Unternehmen zur Finanzierung dieser Direktzusage regelmäßig Rückstellungen bilden muss. Diese bilanziellen Posten belasten das Unternehmensergebnis. Und sie unterliegen den Risiken aus den gesunkenen Zinsen und der versicherungsmathematisch abgebildeten Lebenserwartung, die sich teilweise erst lange nach dem Ausscheiden des Geschäftsleiters verwirklichen. Die Rückstellungen sind dann beträchtlich – und letztlich schwer kalkulierbar – nachzudotieren.
Konsens für neues System
Das Problem verschärft sich bei öffentlichen Unternehmen, bei denen die Öffentlichkeit die Gesamtvergütung der Geschäftsleiter besonders kritisch beobachtet. Rund drei Viertel der befragten Aufsichtsräte und immerhin zwei Drittel der Geschäftsleiter halten eine grundlegende Systemumstellung aufgrund der gestiegenen Risiken für unvermeidlich. Auch diese Einschätzung unterscheidet sich kaum zwischen den Branchen oder den Trägern der Unternehmen (Bund, Länder oder Kommunen).
Umstellung auf Beitrag
Die bAV-Systeme werden längst umgestellt: In der Privatwirtschaft wurden vor längerer Zeit teure Versorgungswerke für die Mitarbeiter geschlossen. Es folgten die Versorgungszusagen für Vorstände: Seit einigen Jahren werden Neuzusagen überwiegend beitragsorientiert erteilt.
Die öffentlichen Unternehmen folgen diesem Trend ebenfalls, allerdings verzögert. Neu bestellte Geschäftsleiter bekommen zunehmend beitragsorientierte Zusagen, die nicht mehr ein bestimmtes zu erreichendes Versorgungsniveau enthalten, sondern lediglich eine bestimmte Dotierung (»Beitrag«). Zumeist wird die Abwicklung dieser Zusagen auf einen externen Versorgungsträger ausgelagert, etwa eine durch eine Versicherung rückgedeckte Unterstützungskasse. Das spätere Versorgungsniveau hängt hierbei von der Beitragshöhe ab, aber auch maßgeblich von der darauf zugesagten beziehungsweise von dem externen Träger inklusive Überschussbeteiligung erzielten Verzinsung.
“20 Jahre 30 Prozent abgeführt ergeben realistischerweise nur 20 Prozent des letzten Gehalts”
Unterschätzte Versorgungslücke
Die Höhe der Beiträge ist damit der entscheidende Modellparameter. Nach einschlägigen Modellrechnungen ist bei einem Beitrag von beispielsweise 30 Prozent der Festbezüge – ein nicht untypischer Wert – nach einer typischen 20-jährigen Dienstzeit als Geschäftsleiter derzeit ein späteres Versorgungsniveau von ungefähr 20 Prozent der letzten aktiven Grundbezüge realistisch. Der Rest der Versorgungslücke ist dann durch andere Versorgungsformen zu schließen: zuvor erworbene Ansprüche, gegebenenfalls gesetzliche Rente und vor allem Eigenvorsorge.
Vielen Chefs dürfte dies nicht ganz bewusst sein. Denn trotz dem fast allseitigen Ja zu einem neuen System wünschen 75 Prozent der befragten Betroffenen, nach 15 bis 20 Jahren in der Chefposition mehr als 40 Prozent der letzten Grundbezüge als Ruhegehalt.
Oder nur Zuschuss
Manche Unternehmen gehen weiter: Sie zahlen neu bestellten Geschäftsleitern nur noch einen »Zuschuss« zum Aufbau einer privaten Vorsorge. So geben einige Sparkassenverbände bereits als Regelfall einen Bruttozuschuss für neue Vorstände vor, die klassische bAV dagegen nur noch ausnahmsweise. Die Folge: Der Geschäftsleiter muss seine Versorgung grundsätzlich aus versteuertem Einkommen aufbauen. Dies mindert ihren Wert trotz der günstigeren nachlaufenden Pensionsbesteuerung beträchtlich.
“Der Wettbewerb um Topmanager wird härter.”
Eigenvorsorge zumutbar?
Ist nun kommunalen Chefs private Eigenvorsorge zuzumuten und eine Versorgungszusage damit entbehrlich? Bei dieser Frage endet – wenig überraschend – der Konsens zwischen der Manager- und der Kontrolleur-Ebene, zeigt die Kienbaum-Befragung: Rund 80 Prozent der befragten Aufsichtsräte bejahen diese Frage angesichts der Chefgehälter. Dagegen sagen drei Viertel der Geschäftsleiter nein.
Das Gesamtpaket muss stimmen
So verständlich die Auffassung der Aufsichtsräte auf den ersten Blick ist, so birgt sie doch durchaus Gefahren: Die Anforderungen an Topmanager wachsen, weil sich Geschäftsmodelle wandeln – Stichworte Digitalisierung, Energiewende, neue Verkehrskonzepte. Daher wird der Wettbewerb gerade um Spitzenkräfte, die diesen Wandel proaktiv gestalten, weiter zunehmen. Da muss auch die Gesamtvergütung attraktiv bleiben, auch gegenüber der Privatwirtschaft.
Das Ergebnis heißt sicher: »Vollversorgung ade!« Zu begrüßen sind aber Gesamtpakete mit einer transparenten, das Unternehmen nicht überlastenden und zugleich für den Betroffenen annehmbaren Versorgungskomponente, die um Eigenvorsorge ergänzt wird.
Martin von Hören gehört der Geschäftsleitung von Kienbaum Consultants International an und ist dort Director sowie Partner. Rechtsanwalt Tom Feldkamp ist dort Manager im Geschäftsfeld Compensation & Performance Management.
Über die Befragung:
Kienbaum Consultants International hat zwischen Mai und Juli 2019 rund 100 Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Beteiligungsmanager öffentlicher Unternehmen zu ihrer Organtätigkeit befragt. Bis jetzt waren die Ergebnisse ausschließlich den Befragten zugänglich. Der nebenstehende ZfK-Gastbeitrag fasst die Resultate erstmals und exklusiv für eine breitere Fachöffentlichkeit zusammen. Die Unternehmen stammen vor allem aus den Branchen Energie- und Wasserversorgung, Verkehr und Logistik, Banken/Sparkassen, Wohnungswirtschaft/Immobilien, Messegesellschaften sowie Wirtschaftsförderung. Zwischen den einzelnen Branchen und/ oder Trägern (Bund, Länder, Kommunen) gebe es keine signifikanten Unterschiede, was die Verbreitung und Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) von Geschäftsleitern angeht, meint die Unternehmensberatung.
Dieser Artikel ist ursprünglich in Ausgabe 02/20 der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) erschienen: Zur Zeitung für kommunale Wirtschaft.
Laden Sie den Artikel hier als PDF herunter: Zum Download.